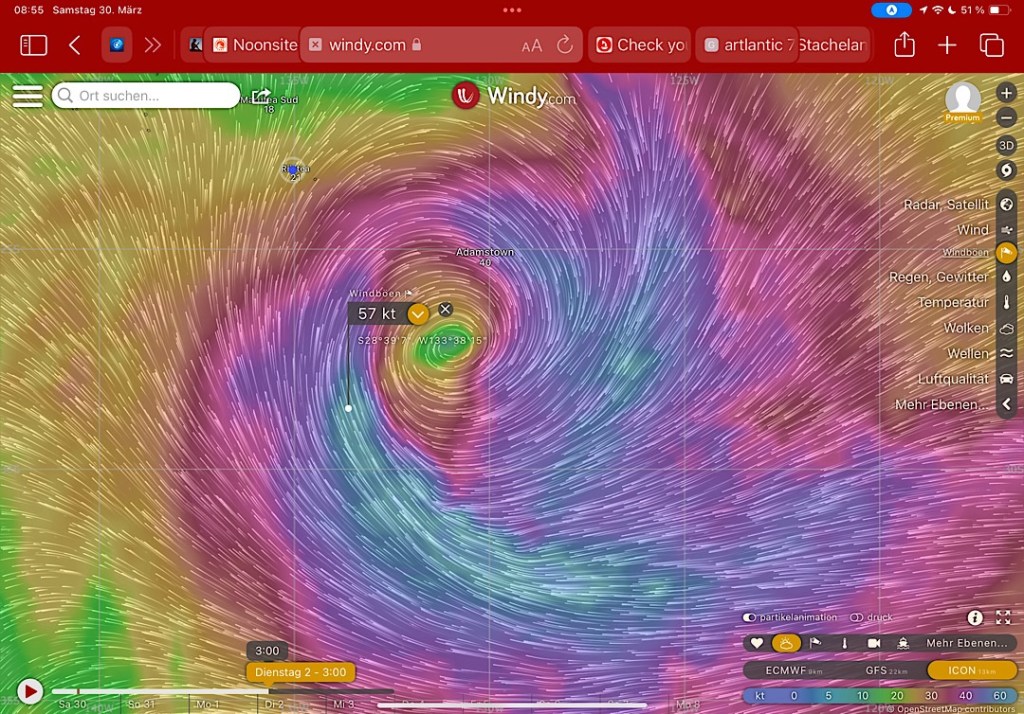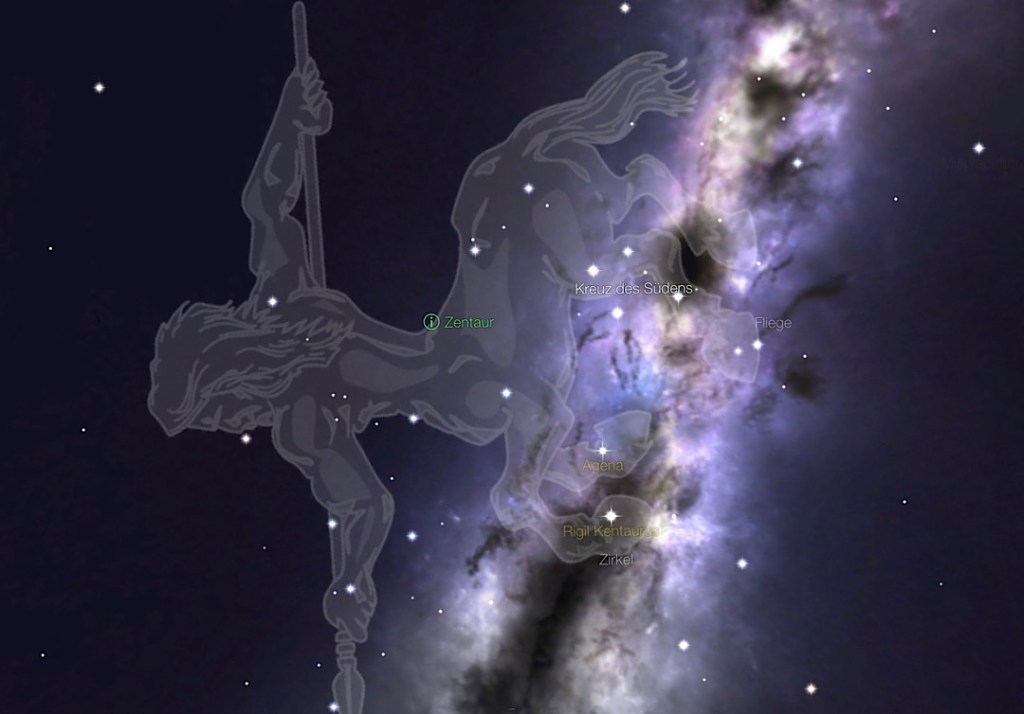Der wunderschöne Ankerplatz von Hanavave auf Fatu Hiva hat sich geleert, zwischenzeitlich sind wir nur noch fünf Boote hier. Unsere Nachbarn sind schon weiter gezogen, erkunden bereits andere Inseln der Marquesas, aber wir bleiben noch ein bisschen.

Einen ruhigen Tag verbringen wir einfach auf dem Schiff, genießen die einzigartige Szenerie und die verschiedenen Licht-Schatten-Spiele der Basaltmonoliten vor dem Hintergrund der steilen grünen Berghänge.
Am nächsten Tag machen wir wieder eine Wanderung. Es soll 9 km weit zu einem 450 m hohen Gipfel über der Bucht gehen, also brechen wir zeitig auf, um bei den ohnehin hohen Temperaturen nicht auch noch in die Mittagshitze zu kommen. Guter Plan, aber die Umsetzung klappt nicht so recht. Auf dem Weg durch das Dorf fällt uns ein eine mit luftigem Mesh eingehauste Plantage auf. Was mag das sein?

Der Nachbar kommt von seinem Grundstück herüber und klärt uns auf. Es ist eine von offizieller Seite angelegte Testanpflanzung von Vanille. Wird aber aus seiner Sicht nicht intensiv genug gepflegt. Und wo wir schon mal im Gespräch sind, lädt uns Henry gleich zu sich in seinen Garten ein. Wir werden der Familie vorgestellt, die auf der Terrassenwerkstatt gerade an Knochen- und Muschelschnitzereien arbeitet. Henry selbst ist eigentlich mit dem Anschleifen von Balsaltsteinen für mehrere Tiki beschäftigt.

Aber das kann jetzt ruhig warten, statt dessen werden wir mit Früchten aus dem Garten überhäuft. Neben Mango, Bananen, Papaya, Pampelmusen und Zitronen bekommen wir erstmals auch Ambarella (polynesische Goldpflaume). Henry erklärt uns, dass sie hier grün (unreif) gegessen wird, wobei die Schale nicht mitgegessen wird.

Im Gespräch erfahren wir, dass Henry eigentlich von den Gambier kommt. Hm, da waren wir ja gerade. Wen wir dort kennen? Wir berichten und es stellt sich heraus, dass Pakoi (von Aukena) sein Cousin ist. Als wir ihm die Fotos von Pakoi und uns zeigen, ist er ganz aus dem Häuschen und auch seine Frau muss sich die Bilder gleich noch einmal ansehen. Es ist eine kleine Welt.
Unsere ganzen Gartengeschenke sollen wir nicht mit auf die Wanderung nehmen, sondern erst mal da lassen und auf dem Rückweg abholen. Das Angebot nehmen wir gern an und übrigens – für die Skeptiker – auch beim Abholen wird uns kein Verkauf angeboten, sondern einfach der Fruchtberg in die Hände gedrückt.
Jetzt sind wir natürlich doch später unterwegs und es wird eine anstrengende Wanderung, obwohl der Weg auf der wenig befahrenen Straße entlang führt. Die Serpentinen ziehen sich so steil den Berg hinauf, dass wir nach einiger Zeit lieber auf der gesamten Straßenbreite im Zickzack gehen. So mindern wir die Steigung und damit das Gefühl, eine Treppe hinauf zu gehen.


Am Point de Vue ist nur Zwischenstation, es geht weiter steil bergan. Dafür werden wir aber mit herrlichen Ausblicken auf das Dorf, die Küste und die nördlich des Dorfes liegenden schroffen Felszacken belohnt.





Die Betonstraße (weiter oben Schotterstraße) schlängelt sich am Hang entlang, mehr als einmal können wir weit unter uns Flora am Ankerplatz liegen sehen.



Bei der Steigung gehen die 9 km dann aber doch ganz gut in die Beine (rauf) bzw. auf die Knie (runter), wieder an Bord sind wir rechtschaffen kaputt.
Trotzdem schafft es Wiebke noch, einen Zitronenkuchen zu backen. Heute suchen suchen wir dann noch einige aussortierte Kleidungsstücke heraus, packen ein Sortiment Stifte für Henrys Enkel und einige Stücke Zitronenkuchen dazu und gehen nochmal zu Henry, um uns mit Gegengeschenken für die polynesische Gastfreundschaft zu bedanken. Das kommt ausgesprochen gut an. Zwei von Henrys Söhnen sind gerade da, beide sprechen (wie Henry) gutes Englisch. Einer der Söhne ist Tätowierer und beide erklären uns die Bedeutung der verschiedenen klassischen Motive.
Und Henry zeigt uns, wie und mit welchen Werkzeugen er aus den Steinen Tiki herausarbeitet. Gemeinsam erläutern sie uns den religiösen und historischen Hintergrund der Tiki und welche Bedeutung Tiki für die Marquesas auch heute noch haben.


Und ohne ein weiteres Gastgeschenk – diesmal ist es selbstgefertigter Schmuck – lassen sie uns nicht gehen. Die polynesische Gastfreundschaft ist immer wieder überwältigend.
Im kleinen Dorfladen kaufen wir noch ein paar Lebensmittel, gönnen uns ein Eis. Als wir danach zurück an Bord kommen, fängt es gerade an zu tröpfeln. Dann wächst es sich zu einem fulminanten Tropenregen aus, der fast den ganzen Nachmittag anhält. Zeit für das Kochen einer asiatischen Teriyaki Gemüsepfanne mit von Henry mitgegebenen Maniok und außerdem auch noch das Backen einer wunderbaren Key Lime Pie (Wiebke).

Oder für den großen Service am Generator (Ralf). Danach zur Abkühlung eine Tropendusche auf dem Achterdeck.

Erst zum Abend klart es dann doch wieder auf.



Ist das schön hier auf Fatu Hiva!